Ansichten eines Freiers
Text und Fotos: Klaus Petrus, Kapitel aus dem Buch Am Rand (erschienen März 2023)
Über tausend Mal war Familienvater Markus B. bei Prostituierten. Bemerkt hat es niemand.

Manchmal hat Markus B., 47, Ingenieur, ein paar Stunden später schon vergessen, dass er bei einer Prostituierten war. Dann steht er, ein gewöhnlicher Typ von gewöhnlichem Aussehen, zurückhaltend und gescheit, womöglich in der Küche seiner 4,5-Zimmer-Wohnung, es ist halb sieben in dieser anderen Welt, er hackt Zwiebeln, schneidet Tomaten, geht auf den Balkon eine rauchen, setzt sich an den Tisch und isst, er erzählt von der Arbeit oder hört seiner Frau zu, die er liebt und bewundert, später wird er noch in einem Buch lesen oder schaut eine Serie oder bezahlt Rechnungen.
So ungefähr, sagt Markus B., sind die Abende bei ihnen, dem Ehepaar B. mit Tochter Lara, 17 Jahre und voll Teenie.
Und wenn es zufälligerweise ein Dienstag ist, an dem er in der Küche steht und Zwiebeln hackt, wird er diese Woche noch zu einer anderen gehen, die Yari heisst, Jasmin oder Mia. Dann macht er früher Schluss auf der Arbeit, schickt eine Whatsapp oder ruft an, verabredet Zeit und Ort, höchstens eine halbe Stunde soll es dauern mit allem Drum und Dran. Manche, sagt Markus B. und nickt vor sich hin, schnappen mit ihren Kollegen nach der Arbeit noch ein Bier oder zwei, bevor es nach Hause geht. Nicht viel anders sei das bei ihm: Schnell eine Nutte knallen und dann ab zur Alten, so nannte er das früher.
Früher, das war 2005 und für Markus B., damals Anfang dreissig und seit vier Jahren verheiratet, das erste Mal. In Freiburg, nach einem Arbeitsessen, schlenderte er durch die Altstadt, er kam an der Grand-Fontaine vorbei, da winkte ihn eine Frau herbei, um die fünfzig und Schweizerin, «Hundert», habe sie gemurmelt, und er ging hinter ihr her in dieses abgetakelte Haus, einfach so («ich war weder betrunken noch notgeil»), er stieg die Treppe hinauf, das Zimmer voller Parfüm, das Bett frisch bezogen, an der Wand klebte ein Poster mit wilden weissen Pferden darauf und wilden weissen Wolken, an alles könne er sich erinnern, an die Musik, die im Hintergrund lief, und wie sie dalag und er auf ihr, keuchend, an das kurze Gespräch danach, als alles vorüber war, so unkompliziert und irgendwie auch schön.
In den Wochen danach ging Markus B. immer wieder zu Yvonne an die Grand-Fontaine, er freundete sich ein bisschen mit ihr an, und für Momente meinte er gar, sie retten zu müssen, vielleicht wie Jack Lemmon in Billy Wilders Film «Irma la Douce» die bezaubernde Shirley MacLaine für sich retten wollte.
Dann verlor er das Interesse an Yvonne, von einem Mal aufs andere. In einem der Freier-Foren im Internet, die er inzwischen rege besuchte, hiess es, ihr Service sei zwar zuverlässig, aber kühl. Ist so, dachte Markus B., und: schade ums Geld. Er legte sich einen Benutzernamen zu, «Lemmy», und hinterliess auf dem Forum seinen ersten von bisher 474 Posts mit den Worten: «Location so lala, Service mechanisch, Wiederholungsgefahr 3/10.»
Wenn Markus B. sich zu erklären beginnt, drückt er Daumen und Zeigefinger zusammen, dabei gibt es, meint er, gar nicht viel zu sagen: Natürlich sei das irgendwie verwerflich, viele dieser Frauen hätten ja keine Wahl. Ein Vergnügen sei das bestimmt nicht für sie, harte Arbeit halt. Süchtig? Nein, er könne auch ohne. Während Corona zum Beispiel, da habe er über Wochen keine gehabt, oder vielleicht zwei oder drei, genau weiss er es nicht mehr. Und nein, sagt Markus B. und regt sich furchtbar über das Klischee auf, er suche bei Prostituierten nichts, das er nicht auch zu Hause haben könnte, ihn interessierten weder ausgefallene Sexualpraktiken noch «Girlfriend-Sex», das Kuscheln mit anderen Frauen. Bloss das nicht.
Mit Tanja, seiner Ehefrau, hat er einmal die Woche Sex, manchmal möchte er öfter, okay, aber kein Problem, sagt Markus B. und lächelt. Seit sie ihr eigenes Geschäft hat, eine kleine Beratungsfirma, auf die er genauso stolz ist wie seine Frau, ist die Zeit noch knapper geworden, auch für den Sex. An den Wochenenden machen sie es sich auf dem Sofa bequem, sie reden miteinander oder schauen sich einen Film an, auch gut, sagt Markus B., ist doch normal.
Manchmal, wenn sie vom Ausgang heimkommen und beide ein bisschen angetrunken sind, da möchte sie von ihm härter angefasst werden, was ihn nicht stört, aber auch nicht besonders anmacht. Dann tut er es für sie. Wie er überhaupt vieles für Tanja tut, denn sie sei die Stütze seines Lebens, sagt Markus B., sie halte ihn in Schuss, und er schätze sich glücklich, so als Mann und auch als Vater.
Und dann, erzählt Markus B., sei da immer wieder dieser Kick, eine Unruhe, die ihn überkomme, ein Kribbeln: Wenn er die Sexportale aufruft, auf dem Display seines Handys mit dem Finger die Bilder der Frauen wegwischt oder auf ein Foto draufhält, er die Liste der Dienstleistungen durchgeht mit Ausschau auf eine, die alles macht – «Sex in jeder Position, Handjob, Analsex, Blasen mit Schlucken (Aufpreis 50 Franken), Gesichtsspritzen, Facesitting, Mehrfachspritzer und ältere Herren willkommen»; wenn er ihre Nummer wählt, wenig später ins Auto steigt und vielleicht noch Tanja schreibt, dass er zum Einkauf fährt; wenn er vor der Tür steht und klingelt und wenn diese Frau aufmacht, unbekannt und halbnackt, und er das Zimmer betritt und den Hunderter auf das Bett legt, ein wenig beschämt; wenn sie ihn flüchtig auf die Wange küsst und fast garantiert «Schatzeli» sagt und ihm eine Cola anbietet, was er mit einem Merci ablehnt; wenn er sich auszieht und dabei unnötig pressiert, während sie sich im Bad noch schminkt und auf seinen Wunsch hin Stiefel anzieht oder ein besonders neckisches Kleidchen; wenn er Hemd, Jeans und Unterhose auf den Stuhl stapelt, die Socken in die Schuhe stopft und er sich hinlegt, die Decke anstarrt oder den Spiegel an der Wand, den rosaroten Duftbesprüher, die Dose mit Kondomen, die Dildos in verschiedenen Farben und Grössen; wenn sie dann reinkommt, leichtfüssig, sich über ihn beugt und wieder «Schatzeli» haucht, und: «Was machen wir?»; wenn er sie in Position bringt und von hinten nimmt, bevor sie es ihm noch mit dem Mund macht bis er kommt, sein Standardprogramm; wenn er zwanzig Minuten später auf seine Uhr schaut, die er immer anbehält, und er in Gedanken zurück bei der Arbeit ist, beim Sport oder der Familie, und sich alles normal anfühlt.
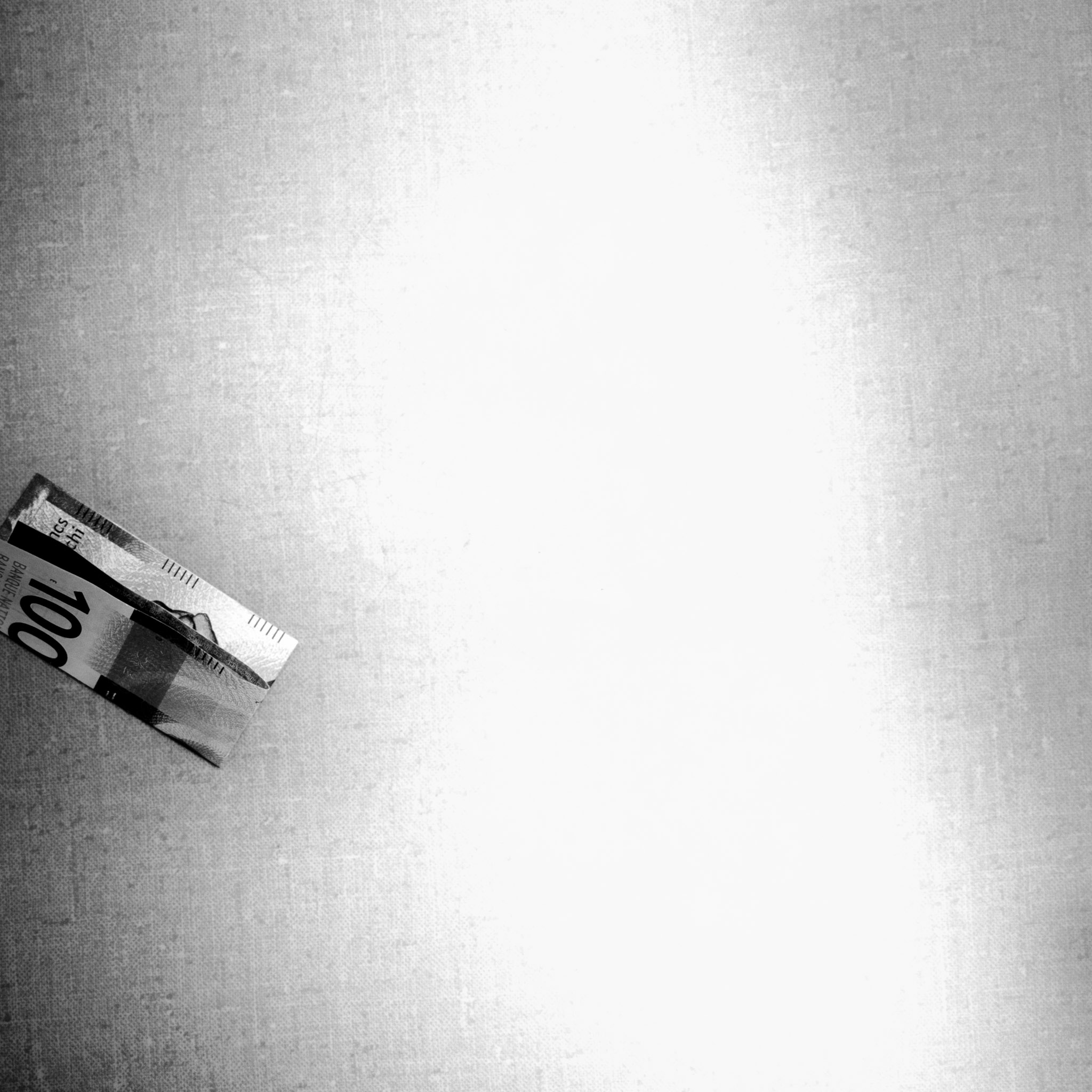
Vielleicht sei am Ende genau das der Kick, sagt Markus B.: dass es immer noch so unkompliziert sei wie damals bei dieser Yvonne an der Grand-Fontaine und anders als daheim, wo alles passen müsse, Wochentag, Gefühlslage, das verdammte Kopfkino, damit es dann endlich stimmt, manchmal wenigstens.
«Hier stimmt immer alles», sagt Markus B.
Zwei- bis dreimal die Woche macht er das so, seit Jahren. Diese Prostituierten, das sagt Markus B. geradeheraus, haben für ihn keine Namen, sie sind austauschbar, sein Feierabendbier sozusagen. Sie kommen aus dem Osten, aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine, sind jung und bleiben nur kurz, so ist immer genügend «frisches Fleisch auf dem Markt», wie es unter Freiern heisst.
Das hält Markus B., der sich ausgesprochen höflich gibt und sein Haar scheitelt – vielleicht das Auffälligste an ihm –, übrigens für unflätiges Geschwätz. Wie er auch den Ton abstossend findet, in dem oft auf Freier-Foren Prostituierte bewertet werden.
«Voll die Abzocke, diese ungarische Schlampe», liest Markus B. vor und scrollt auf seinem Tablet rauf und runter: «Bläst mit den Zähnen, fickt unterirdisch.» «Ihre Titten hängen bis unter den Nabel, was soll da mein Kleiner sagen?» «Ziemlich verbraucht, die Alte, bin aber aus Mitleid dann doch geblieben.» «Stöhnt dumm in der Gegend rum, lässt sich aber blank durchziehen.»
Diese Posts, sagt Markus B. und sucht nach dem Wort, seien respektlos, sie würden die Prostituierten kaputtmachen, seelisch wie finanziell.
Und dann spricht er, für einmal ohne Punkt und Komma, von Ausbeutung, raffgierigen Zuhältern («ein widerliches Pack, wenn Sie mich fragen»), vom fehlenden Anstand der Freier, von der geringen Wertschätzung des Service der Prostituierten, denen es am Ende doch um dasselbe gehe wie allen anderen auch, ob Ingenieur, Schreiner oder Kosmetikerin: die Arbeit, für die man sein Geld bekommt, einigermassen ordentlich zu verrichten.
Thais, rühmt Markus B. und presst wieder einmal Daumen und Zeigefinger zusammen, seien diesbezüglich 1A: gewissenhaft, sauber, ergeben, sympathisch. Mit ein paar Klicks holt er, wie zum Beweis seiner über die Jahre erworbenen Kennerschaft, eine seiner Bewertungen hervor, datiert auf den September 2018 und, wie er betont haben will, fair und sachlich:
«Zierliche Thai, Naturbusen mit grossen Nippeln, sehr hygienisch, raucht nicht, stösst beim Doggy dagegen, bläst ohne Handeinsatz, lässt sich gerne lecken. Location sauber und diskret, entlöhne meistens 150 für 30 Min. Preis-Leistungsverhältnis: 8/10, Optik: 7/10, Service: 8/10, Sympathie: 9/10, Wiederholungsgefahr: definitiv. – Besucht sie, geniesst sie, seid nett zu ihr, sie hat es verdient, euer Lemmy.»
Die Rede ist von Pan, zu der Markus B., alias Lemmy, seit Jahren schon geht, eine von zwei Frauen, die er mit Namen nennt und die angeblich all seine Vorlieben kennt und er auch die ihren, die mit ihm mitunter einen «Tee danach» trinkt und die manchmal, scherzhaft und in tadellosem Deutsch, zu ihm sagt: «Wollen wir uns ein bisschen lieb haben?»
Dass Markus B. zu Prostituierten geht, weiss in seinem Umfeld keiner. Der Mann geht keine Risiken ein, er löscht jeden Anruf, jeden Chat, er parkt zwei Strassen vom Ort des Geschehens entfernt oder nimmt extra den Zug, er bezahlt immer in bar, benutzt, nachdem er gekommen ist, nie eines dieser parfümierten Feuchtigkeitstücher, die ihn daheim verraten könnten, und für die Dusche danach bringt er die eigene Seife mit.
Die monatlichen Auslagen für seine Besuche bei den Prostituierten kaschiert Markus B. mit Autoreparaturen, Sportartikeln, Ausflügen mit Freunden, teurem Wein und so weiter, hier 70 Franken, dort 120 oder auch 500, alles erfundenes Zeugs. Sein Glück sei es, sagt Markus B., dass er und seine Frau nicht jeden Franken umdrehen müssten.
Kommt in Gesellschaft das Thema Prostituierte auf und wer schon mal im Puff war oder wie oft, so sagt er bestimmt und mit einem Kopfschütteln: «Könnte ich nie, würde ich nie, mache ich nicht.»
Was Markus B. stört – «ankotzt», das ist sein Wort –, ist diese Doppelmoral, die Heuchelei derer, die Freier verurteilen und zugleich ihre Freundinnen und Ehemänner hintergehen: sein bester Freund zum Beispiel, der seit Jahr und Tag mit einer Arbeitskollegin rummacht, Kumpels aus dem Sportverein, alle verheiratet und am Tindern mit eindeutigen Absichten, eine Freundin von Tanja, ebenfalls verheiratet und Mutter von drei Kindern, die – peinlich genug, wie Markus B. findet – mit ihrem Chef ins Bett steigt.
Bald fünfzig sei er jetzt, sagt Markus B., doch eine Affäre hatte er noch nie.
Überhaupt kann er sich das, emotional, gar nicht vorstellen: die eigene Frau so zu betrügen – mit einer Beziehung, bei der Liebe im Spiel ist, wo Hoffnungen gemacht und Versprechen gebrochen werden. Dass auch Tanja ihn schon betrogen haben könnte nach bald zwanzig Jahren Ehe, hält Markus B. für wahrscheinlich, aber ihm ist lieber, er weiss nichts davon. Und ja, fügt er an, bestimmt krachte eine Welt zusammen, würde sie von all dem erfahren, von diesen jahrelangen, vorsätzlichen, bis ins Allerletzte kalkulierten Lügereien.

Und dann das viele Geld, um das er ja, irgendwie, auch seine Frau betrogen habe, die ganze Familie: 900 pro Monat x 12 x fast 15 Jahre macht 162 000 Franken. Oder plus/minus in Anzahl Dienstleistungen umgerechnet, die er bis dato von Prostituierten in Anspruch genommen hat: 1300.
Der Ingenieur aus Bern wiegt den Kopf und lächelt, wie sein Mund immer lächelt, wenn er die Lippen zusammenpresst.
Vor Jahren hat Markus B. einmal ausgerechnet, wie viele Zigaretten er bisher geraucht und was ihn das gekostet hat. Als er das Total vor sich sah, scheuchte er sein schlechtes Gewissen weg wie eine lästige Erinnerung und dachte bei sich: «Das kann unmöglich sein.»
